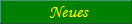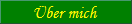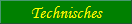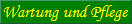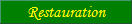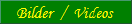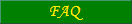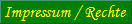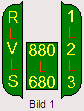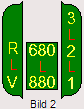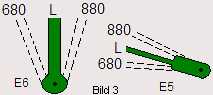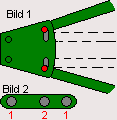Technisches
Hier findet Ihr alle Daten zu den Motoren und Getrieben
sowie die Erläuterungen zu Getriebe- und
Holmfunktionen. Die Spurweiten geben die Gesamtbreite an.
Noch was zur Zapfwellengeschwindigkeit: Die angegebenen
Werte sind die, die am meißten genannt werden. Denn
insbesondere beim E5 stehen fast überall unter- schiedliche
Geschwindigkeiten!
Alle Angaben sind allgemein gehalten und können, je nach
Modell, variieren oder nicht vorhanden sein.
1. Motor
1.1
E5
1.2
E6
2. Getriebe
2.1
E5
2.2
E6
2.3
Gemeinsamkeiten
3.
Weitere
Daten
4. Technische Erläuterungen
4.1
Schaltung
& Zapfwelle
4.2
Holmverstellung
4.3
Zapfwellensperre
4.4
Gewichtsangaben
4.5
Typenschild
4.6
Zyklonluftfilter 
1.
Motor
1.1 E5
|
Typ
|
Stamo
200
|
|
Hersteller
|
Fichtel&Sachs
AG
|
|
Arbeitsweise
|
2
- Takt Benziner mit Gegenstromspülung
|
|
Kühlung
|
Durch
Gebläse
|
|
Mischung
|
1:25
|
|
Hubraum
|
193
cm³
|
|
Drehzahl
|
3.500
U/min
|
|
Leistung
|
5,0
PS
(3,8 kW)
|
|
Standgeräusch
|
 182
KB 182
KB
|
|
Extras
|
Zündanlage mit
Lichspule
|
1.2 E6
|
Typ
|
Stamo
200
|
|
Extras
|
Dekompressor
|
|
|
Ansonsten
ist
er mit den Daten des E5 gleich.
|
|
Typ
|
Stamo
201
|
|
Hersteller
|
Fichtel&Sachs
AG
|
|
Arbeitsweise
|
2
- Takt Benziner mit Umkehrspülung
|
|
Kühlung
|
Durch
Gebläse
|
|
Mischung
|
1:25
|
|
Hubraum
|
191
cm³
|
|
Drehzahl
|
3.500
U/min
|
|
Leistung
|
5,8
PS
(4,4 kW)
|
|
Standgeräusch
|
 120
KB 120
KB
|
|
Extras
|
Zündanlage
mit Lichtspule
Vergaser mit Kugelregler (Grobregler)
Dekompressor bei den frühen Modellen
|
Für
mehr
detaillierte Infos zu den Motoren, siehe "Sachs
Stationärmotoren".
2.
Getriebe
2.1 E5
|
Kupplung
|
Mehrscheiben
-
Lamellenkupplung
|
|
Luftfilter
|
-
Zyklonvorabscheider mit Nassluftfilter
- Zyklonvorabscheider mit Microniceinsatz
|
|
Zapfwelle
(Linkslauf)
|
540 / 750
U/min
|
|
Gewicht
|
100
kg
|
2.2 E6
|
Kupplung
|
-
F&S Einscheiben - Trockenkupplung K 3,5
- F&S Einscheiben - Trockenkupplung K 140
|
|
Luftfilter
|
-
Zyklonvorabscheider mit Nassluftfilter
- Ölbadluftfilter
|
|
Zapfwelle
(Linkslauf)
|
540 / 840
U/min
|
|
Gewicht
|
108
kg
|
2.3 Gemeinsamkeiten
|
Bauart
|
Leichter
Universal
- Einachsschlepper
|
|
Getriebeart
|
4 -
Gang
Wechselgetriebe mit Wendegetriebe
|
|
(R)
Rückwärts
|
1 / 2 / 3
|
|
(V)
Vorwärts
|
1 / 2 / 3
|
|
(S)
Vorwärts
schnell
|
1
|
|
Geschwindigkeitsangaben
|
1.
Gang
2. Gang 3.
Gang 4. Gang
|
|
Bereifung
4.00
- 8 AS
|
1,04
2,77
4,15 12,70
km/h
|
|
Bereifung
4.00
- 12 AS
|
1,29
3,34
5,15 15,60
km/h
|
|
Bereifung
6.00
- 12 AS
|
1,42
3,67
5,67 17,16
km/h
|
|
Bereifung
6
- 9 AS
|
1,29
3,34
5,15 15,60
km/h
|
|
Spurweiten
(min
- max)
|
|
|
4.00
-
8
|
380
-
640
|
|
4.00
-
12
|
440
- 615 / 700
|
|
Stahlräder
380
|
320
/
410 - 580 / 670
|
|
Stahlräder
580
|
700 -
780
|
3. Weitere Daten
Der
E5
/ E6 verfügt über einige "Extras", wobei manche eigentlich
nichts be- sonderes sind, da diese auch bei Schleppern
anderer Marken verbaut sind. Aber sie machen das Arbeiten
einfacherer und sicherer.
Interessant ist vor allem, dass auch der Motor auf die
Bedürfnisse eines Schmal- spurschleppers ausgerichtet ist:
Dieser kann mit einem 13,5 cm schmalen Auspuff
ausgerüstet werden, anstatt des normalen, 17 cm breiten.
- Dreipolige Steckdose mit 16 W - 6 V
- Solide Innenbackenbremse auf der rechten Seite
- Eine Einzelradlenkung, die das linke Rad vom Antrieb
trennt
- Das Getriebe ist so konstruiert, dass keine Schaltfehler
möglich sind
- Der Schnellgang ist unabhängig vom Wechselgetriebe, so
kann die Kraftüber-
tragung nahezu verlustfrei auf die Räder
übertragen werden
- Die Zapfwelle ist gangunabhängig, z. B. für stationären
Betrieb
- Zapfwellensperre für Rückwärtsgang (nicht serienmäßig)
- Automatische Sperrung des Schnellganges, beim schwenken
des Hauptholmes
über den Motor
- Der Hauptholm ist um 180° schwenkbar
- Die Lenkholme können auf schmal und breit gestellt
werden
- Die Lenkholme sind insgesamt 9x in der Höhe und seitlich
verstellbar
- Integriertes Werkzeugfach
4.
Technische Erläuterungen
4.1 Schaltung & Zapfwelle
Hierbei
handelt
es sich um ein mehrgängiges Zahnräder - Wechselgetriebe,
dem ein Wendegetriebe nachgeschaltet ist.
Also (hier) drei Gänge (Wechselg.), die über einen
Vorwählhebel entweder auf Vor- oder Rückwärtsfahrt
(Wendeg.) geschaltet werden können. Diese Gänge haben
dadurch in beide Richtungen die gleiche Geschwindigkeit.
Sie sind so übersetzt, dass man optimal auf dem Acker
arbeiten kann. Der 1. Gang ist aber nicht als
Kriechgang ausgebildet.
Außerdem kann mit dem Vorwählhebel der 4. Gang, der
sogenannte Schnellgang, geschaltet werden, der allerdings
außerhalb des eigentlichen Wendegetriebes liegt. Denn er
umgeht das Wechselgetriebe, es hat daher keinen
Kraftschluss zur Achse.
Es handelt sich also insgesamt um ein 7 - Gang Getriebe.
Außerdem, wie unten im Schaltschema gut zu sehen, besitzen
beide Getriebe jeweils zwei Leerläufe.
Zu beachten:
Die Gänge sind um eine Stelle nach hinten verschoben. "R"
und "1" können auf dem Schaltschema nicht eingelegt
werden, ebenso gehen die Schalthebel über "S" und "3"
hinaus. Die Leerläufe sind also die Gänge und die Gänge
die Leerläufe.
Das Wendegetriebe darf nicht während der Fahrt geschaltet
werden, dass soll nur bei stillstehenden Rädern passieren.
Sonst drohen langfristig Getriebeschäden!
Lediglich beim Wechselgetriebe ist ein Raufschalten
während der Fahrt möglich.
Die Zapfwelle kann in zwei unterschiedliche
Geschwindigkeiten geschaltet werden, die gangunabhängig
sind. Also egal was für ein Gang im Wechsel- und
Wendegetriebe eingelegt ist, Drehrichtung und
Geschwindigkeit der Zapfwelle bleiben immer gleich. Sie
ist nur von der Motordrehzahl abhängig.
Man kuppelt wie beim Auto: Bei jedem Schaltwechsel
muss ausgekuppelt werden.
Kann ein Gang nicht eingelegt werden, die Kupplung kurz
loslassen und wieder anziehen.
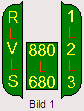 |
Bild
1
zeigt die Schaltung vom Bedienenden aus gesehen.
Die roten "L" sind die Leerläufe und auf dem
Schaltschema natürlich nicht zu sehen.
|
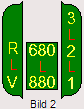 |
Bild
2
zeigt die verfügbare Schaltung vom Bedienenden
aus, wenn der Hauptholm um 180° gedreht wurde.
Durch die automatische Sperre kann der Schnellgang
jetzt nicht mehr eingelegt werden.
|
|
Bild
3
zeigt die Zapfwellenhebelstellung von der Seite.
Merke: Hebel Richtung Zapfwelle = Langsame
Drehzahl
Hebel Richtung Motor
= Schnelle Drehzahl
|
|
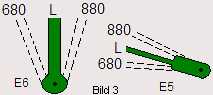
|
4.2 Holmverstellung
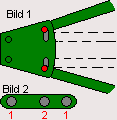
|
Lenkholme
auf
breit / schmal stellen:
Die hinteren Sechskantschrauben (Bild 1 / rot)
öffnen, die rechte herausnehmen. Das
Verstärkungsblech des E5 bzw. die Steckdose beim
E6 haben je 3 Löcher (Bild 2). Um auf schmal zu
stellen, ist die rechte Schraube in Loch 2 um-
zustecken, die linke bleibt in Loch 1. Dabei
verschieben sich beide Schrauben automatisch nach
innen (Bild 1 / grauer Bereich).
|

|
Lenkholme
nach
oben / unten / seitlich stellen:
Hier wird der Handgriff zwischen den Lenkholmen
heraus- gezogen. Diesen dann ggf. leicht gezogen
halten, bis das gewünschte Loch gefunden ist. Der
Bolzen kann auf die in Bild 3 gezeigten Positionen
eingerastet werden. "N" ist die Normal- stellung.
|

|
Hauptholm
schwenken:
Um den Hauptholm nach vorne oder hinten zu
schwenken, müssen zuerst die Schaltstangen,
mittels der Splinte an den Schalthebeln, abgezogen
werden. Dann die Augenschrauben (Bild 4) lösen und
umklappen. Der Hauptholm wackelt zwar, kann aber
nicht umkippen. Er ist nur auspuffseitig schwenk-
bar.
Der Zusammebau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Beim E5 wird der Zapfwellenhebel herausgezogen und
auf den anderen Bolzen wieder aufgesteckt.
|
4.3 Zapfwellensperre

Diese
Sperre
trifft
nur auf die wenigsten E5 / E6 zu, da diese nicht
werksseitig vorgesehen war, sondern nachträglich, also
nach Produktionsende, eingebaut wurde. Auch ist die
Konstruktion nicht willkürlich, sondern erfolgte
weitestgehend nach dem gleich Muster:
Der Bolzen des Zapfwellenhebels ist verlängert, so dass
ein weiterer Hebel montiert werden konnte und an dessen
anderem Ende wurde eine Schraube befestigt. Am
Vorwählhebel ist ein gebogenes U - Eisen angeschweißt
worden.
Dieses System ist so simpel wie einfach: So lange die
Zapfwelle eingeschaltet ist, stößt entweder das obere oder
untere Ende des U - Eisens an die Schraube, der
Rückwärtsgang kann somit nicht eingelegt werden. Erst wenn
die Zapfwelle ausge- schaltet wird, wie im obigen Bild,
passt die Schraube genau in die Aussparung, der Weg zum
Rückwärtsgang ist jetzt frei.
Dieses System hat allerdings den Nachteil, dass
Anbaugeräte, die rückwärts betrieben werden (z. B. das
Mähwerk), nicht mehr benutzt werden können! Die Sperre ist
daher hauptsächlich für den Betrieb mit der Fräse gedacht.
Sie wurde insbesondere in gewerblichen Betrieben, die den
UVV (Unfall - Verhütungs - Vor- schriften) unterliegen,
eingebaut.
Selbst an einem E5, wie oben zu sehen, kann man diese
Sperre finden. Diese wurde so restauriert, wie sie
lackiert war. Er bekam wohl mal einen neuen Holmlagerbock.
Dafür blieb der Zapfwellenhebel und Seilzugführung zur
Kupplung die alte. Auffällig ist auch, dass hier am
unteren Teil des U - Eisens noch eine zusätzliche Strebe
angeschweißt werden musste, sonst hätte man in der höheren
Zapfwellendrehzahl den R - Gang einlegen können.
Im unteren Bild die Einzelteile der Sperre, wie man sie
von Holder bekommen konnte:

Danke
an Max für das Bild, welche ein LaMa-Händler
zufälligerweise, sogar in 2025, noch vorrätig hatte.
4.4 Gewichtsangaben
Ein Einachser ist zwar kein Auto, allerdings wäre es von
Vorteil zu wissen, wie viel der E5 / E6 eigentlich
aushält. Hierzu dienen folgende Angaben:
Zulässiges Gesamtgewicht: Summe aus
Leergewicht+maximaler Zugleistung.
Zulässige Achslast:
Ist
die
Gesamtlast,
die von den Rädern der Achse
auf
die Fahrbahn übertragen wird.
Diese betragen hier beide 250 kg. Zu finden sind die
Angaben in der ABE und dem Typenschild des E6 ab 1963. Das
Leergewicht, hier die volle Ausrüstung, bestehend aus 4.00
- 12 AS mit Gewichten, Nabenzwischenstücken, Schutzbleche
und Frontgewicht, ist daher ca. 186 kg. Bleiben noch etwa
64 kg für die Anbau- geräte (oder anderes).
Bei längerer Überbelastung entstehen Lagerschäden, es kann
auch zu einem Achsbruch kommen. Gleiches geschieht auch
beim befahren von unebenem Gelände (Schlaglöcher) oder
überfahren von Bordsteinkanten bei zu hoher
Geschwindigkeit.
Eine weitere, wichtige Gewichtsangabe ist die
Stützlast: Gewichtslast, die auf die
Anhängevorrichtung des Zugfahrzeugs wirkt.
Diese befindet sich ab ca. 1963 auf dem Typenschild des
Anschlussstückes und beträgt 65 kg. Das ist besonders für
den Anhänger wichtig. Denn ein überschreiten dieser Angabe
kann zum Bruch der Bolzenaufnahme / Anschlussstück führen.
Wichtig ist auch, dass immer langsam eingekuppelt werden
sollte, um die Bolzen- aufnahme zu schonen. Vor allem muss
immer der Sicherungsstift in der Auf- nahmebohrung
stecken, damit sich der Anhängebolzen nicht löst.
4.5 Typenschild
Dieses befindet sich bei beiden auf dem Getriebedeckel
über der Zapfwelle. Ebenso besitzen beide je zwei (grob
gesehen) unterschiedliche Ausführungen.

|
1956
-
1957:
Es ist das größte Typenschild dieser Baureihe und
zeigt dementsprechend auch die meisten Infos.
Es sind sozusagen zwei in einem: Schaltung und
Modellinformationen.
Type: "Einachser, 5 PS".
Diese Bezeichnung ist fest und daher immer
schwarz.
Baujahr: Das Jahr, in dem das Getriebe
gebaut wurde. Das "195" ist immer fest, nur die
letzte Jahreszahl ist gestanzt.
Masch. Nr.: Ist die fortlaufende
Getriebenummer, fängt bei 0001 an und ist immer
komplett gest- anzt.
Leistung: Maximalleistung des original
verbauten Motors, ebenfalls eine feste Angabe.
|
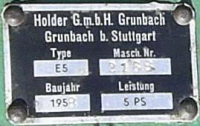
|
1957
-
1959:
Hier wurde auf die Schaltung und den großen
"Holder" Schriftzug verzichtet. Die Infoleisten
wurden anders gruppiert, sonst hat sich nichts
verändert.
|

|
1959
-
1961:
Hier gibt es nur zwei Unterschiede:
Type: Es wurde einfach nur eine Nummer
höher genommen, die später zufällig auf die Motor-
leistung passte.
Masch. Nr.: Diese fängt mit 10.000 an und
ist ebenfalls komplett gestanzt
Foto: Matthias Stroh
|

|
1961
-
1975:
Neu ist das Stempelfeld, Zulässiges Gesamt-
gewicht und Zulässige Achslast.
Beide Angaben sind fest. Die Leistungsangabe
wurde dafür weggelassen. Der feste Zusatz "G"
heißt, dass er in Grunbach gebaut wurde. Des
weiteren gibt es noch die gestanzte
Zusatzbezeichnung "A" oder "B".
(Erläuterung unter "Unterschiede").
Neu
ist auch der schöne Spruch "Made in Germany".
Zur Ergänzung:
Die Zusatzbezeichnungen haben keinen festen Platz.
Normalerweise stehen diese hinter dem "G", können
aber auch vor dem "E" und im Baujahr stehen. Aber
egal wo diese stehen, es heißt immer z.B. "E6 GA".
Foto: Moritz
|
4.6 Zyklonluftfilter 
Bis
ca.
1967 wurden immer Zyklonluftfilter verbaut. Hier der Typ
LZP 1501, mit (fehlendem) Micronicfilter, wie er in die
meisten E5 eingebaut wurde. Dieser Filter war stark
korrodiert, weshalb ich ihn interessehalber mal
aufgeschnitten hatte, um dessen Funktion im Inneren
genauer anzusehen. Hier versuche ich das Konstruk-
tionsprinzip so gut wie möglich zu beschreiben. Die Pfeile
zeigen in etwa die Luft- richtung.
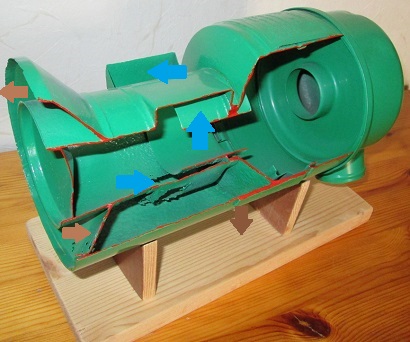
Die
Luft
durchströmt ein Gitternetz, hier komplett entfernt, um den
gröbsten Dreck, wie z.B. Blätter, fernzuhalten. Sie wird
durch drei Schächte angesaugt (blaue Pfeile) und dadurch
in eine Drehbewegung versetzt. Durch die Schleuderwirkung
werden die gröberen, bzw. schwereren Teile an die
Außenwand geschleudert. Damit sich das Gehäuse nicht
gleich zusetzt, sind links zwei Auslassschlitze
(hellbraune Pfeile), sowie ein Loch im unteren Bereich
(dunkelbrauner Pfeil), vorhanden. Letzteres dient auch aus
Ablauf für (Regen-)Wasser.
Die so vorgereinigte Luft erreicht schließlich den
eigentlichen Luftfilter. Am Nassluftfilter kann man die
Zyklonwirkung gut erkennen: Wird er länger nicht
gereinigt, setzt sich der äußere Teil zu, bis nur noch ein
kleines Loch in der Mitte frei bleibt.
nach oben
|